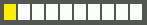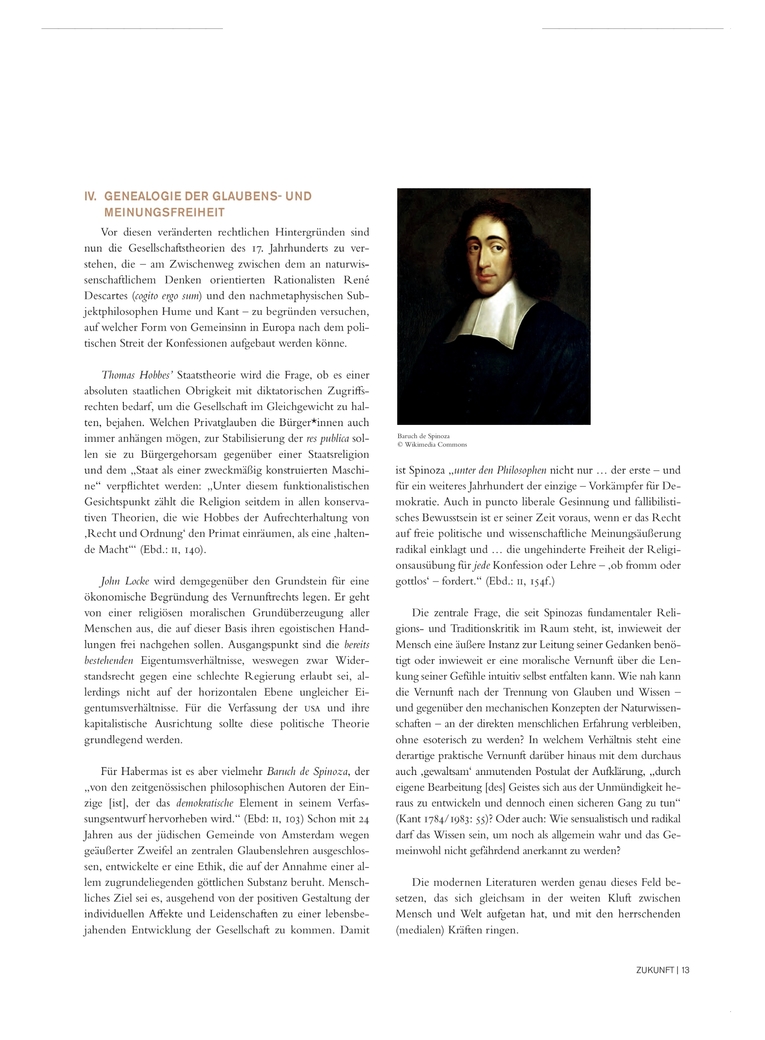20 | ZUKUNFT
Es handelt sich um einen imaginierten, übersetzten
Zdenĕk. Eine der Stimmen im Stück scheint aber zu wis-sen, was diesen Zdenĕk umtrieb, mehr noch, sie „fühlt“ es. Der Abschiedsbrief, in dem „von der Macht und dem Geld die Rede ist“, meint „Etwas anderes“. Etwas nicht Vermit-telbares, das nur gefühlt werden kann. Es fehle eine Überset-zung von Zdenĕks Abschiedsbrief, „[s]owie du sie aber fühlst, dann weißt du. Und wie.“ Es ist also mehr eine vorgestellte, vielleicht ersehnte, Verbindung, die hergestellt wird, ausge-hend von der Vorstellung, dass sich hier einer auch der Spra-che des herrschenden Systems widersetzt: „Schon der Rhyth-mus, womit in Zdenĕks Brief von der Macht und dem Geld die Rede ist, ist ein wesentlich anderer, von Grund auf ver-schieden von all den üblichen Sätzen und Syntaxen von Geld und Macht.«“
IV. BEIM VORNAMEN NENNEN
Bereits in Handkes 2017 erschienenem Roman Die Obst-
diebin oder einfache Fahrt ins Landesinnere kommt eine der Fi-guren auf Zdenĕk Adamec zu sprechen und stellt ihn erneut in eine Ahnenreihe von Menschen, die aus politischem Pro-test Selbstmord begingen – von Jan Palach bis zu dem „chine-sischen Jungen auf dem Platz des Himmlischen Friedens oder wo vor einen Panzer geworfen hat“. Und auch hier klingt schon das Unspezifische des Ortes an, mit dem Zdenĕk Ada-mec eingeleitet wird. Gleichzeitig wird Zdenĕk Adamec zu Zdenĕk, wird in eine Reihe von Freunden und Gleichgesinn-ten, – von Blaise Pascale bis Johnny Cash und Rokia Trao-ré -, von geistigen Verwandten aufgenommen: „Den Zdenĕk kenne ich – inwendig! Er heißt bei mir Zdenĕk ohne Nach-namen […].“
Eine Nähe, die – wenn man die Büchnerpreisrede wie-
derliest – von der Figur wohl auch auf den Autor Hand-ke übertragen werden kann. Zdenĕk Adamec, der für seine Überzeugung bis zum Äußersten geht und dafür mit Miss-achtung gestraft wird, trifft einen Nerv. Was Handke in sei-ner Dankesrede umtreibt ist nämlich das eigene Unvermö-gen, die Konsequenzen zu ziehen: Seine Wut gegen die Welt in Aktion umzusetzen. Etwa protestiert er trotz großer Ab-scheu nicht – so schildert er – gegen den Wehrdienst oder gegen die „heimelige Fremde“. Man müsste, so meint er, „sofort gewalttätig werden“, um der „weltvergessene[n] Rou-tine“ zu entkommen. Aber der Widerstand – gewaltvoll oder nicht – bleibt „eins unter vielen unwirklichen Gedanken-spielen“. Der radikale politische Protest: ein Sehnsuchtsort.
Und das ausgerechnet von Handke, dem gerade in den 70er Jahren, als diese Rede entstand, stets der Vorwurf des Unpoli-tischen, des Rückzugs in die Sprache umwehte. In einem In-terview mit Der Zeit anlässlich des Preises spricht er ebenfalls von der Unmöglichkeit, konkret, tagesaktuell politisch aktiv zu sein. „[E]in unendlich schlechtes Gewissen“
befalle ihn,
wenn er sich sein eigenes Unvermögen sich zu politischen Aktualitäten zu äußern, vor Augen führe, er finde „überhaupt keinen Einstieg, keinen Punkt […], etwas zu sagen oder zu tun.“ Ein Problem, das Jahre später wohl auch in seinen Äu-ßerungen in der Debatte um Serbien und das NaTo-Bombar-dement in den 90er Jahren mündet – eine Debatte, anlässlich derer Handke aus Protest den Büchner-Preis an die Darm-städter Akademie für Sprache und Dichtung zurückgab. Ein Problem, das, siehe Zdenĕk Adamec, für Handke auch heute noch nicht erledigt ist.
Zdenĕk Adamec hat, wenn man die Theaterszene mit die-
ser Rede Handkes querliest, wohl auch in der Begründung für seine Tat, wie er sie in seinem Abschiedsbrief erklärt, ei-nen wunden Punkt getroffen. Er wirft der Welt Korruption in einer Verbindung von Geld, Macht und Institutionen vor, mit den Medien als ihren Agenten und wirkt dabei fast, als hätte er Handke gelesen, wenn dieser von der „vernünftelnden Ge-walt der Macht“ spricht. Auch die Vagheit, die den Texten, dem Abschiedsbrief und Zdenĕk Adamec, inhärent ist, scheint sie zu verbinden – man muss es eben „fühlen“. Bei Handke hat die Abneigung gegen dieses Spiel der ‚Macht‘ aber auch eine körperliche Dimension. Rational ist es kaum zu erklären, es ist eine körperliche, physische Abscheu, die ihn ergreift: „Seit ich mich erinnern kann, ekle ich mich vor der Macht, und dieser Ekel ist nichts Moralisches, er ist kreatürlich, eine Eigenschaft jeder einzelnen Körperzelle.“
Auch in Zdenĕk Adamec spricht eine der Stimmen über
Gewaltphantasien, die das „Abendfernsehen“ und seine Be-richte von verstümmelten, getöteten und gequälten Körpern auslöst. Eine Aggression, eine Wut, die sich gegen sich selbst richtet, „überwältigend […] angesichts von Hinrichtungen, bei Gemetzeln von Staats wegen, obrigkeitlich angeordnet“. Ein Impuls sich selbst zu richten, sich zu „beseitigen, jetzt!, wie dieser und jene dort beseitigt worden sind!“ Was diesem Sprecher nur Gedankenspiel ist, ersehnte Gewalttätigkeit und wohl auch Befreiung, wird von Zdenĕk in die Tat umgesetzt. Die eigene körperliche Zerstörung als stellvertretendes Ur-teil gegen die Mächtigen und gegen die Gleichgültigkeit der Menschen gegen das Schicksal anderer. So steht in Zdenĕk Adamec auch die Sehnsucht zur Debatte über sich selbst als
WINDSAUSEN: WOHIN MIT DER WUT?
VON JOHANNA LENHART