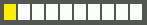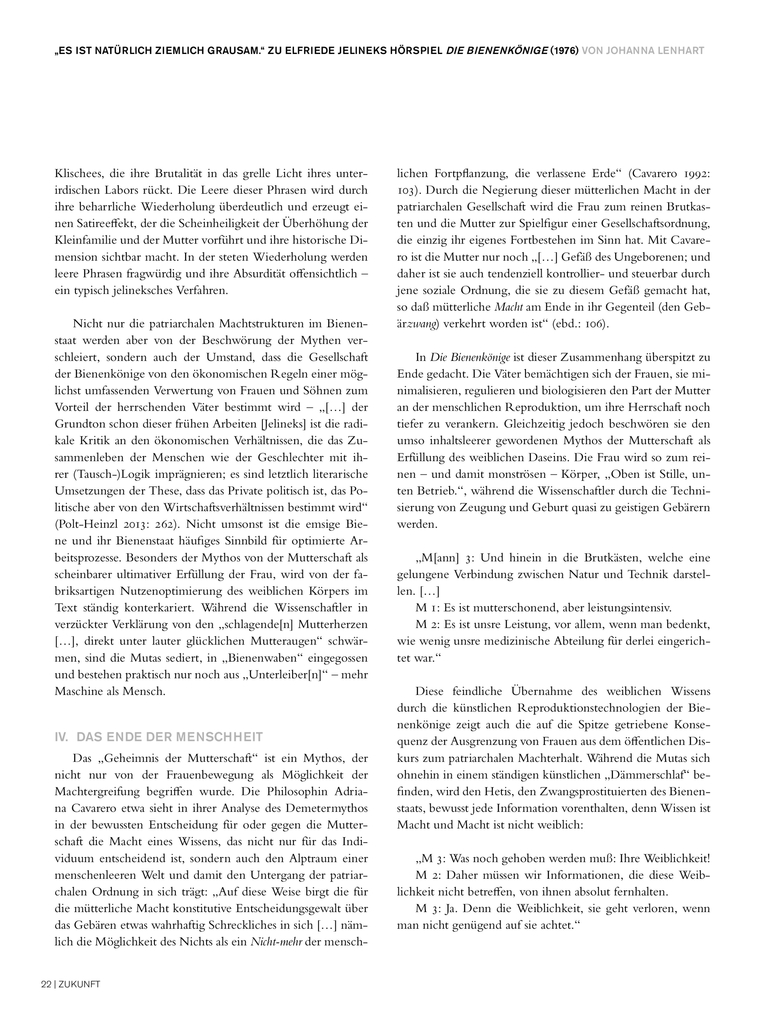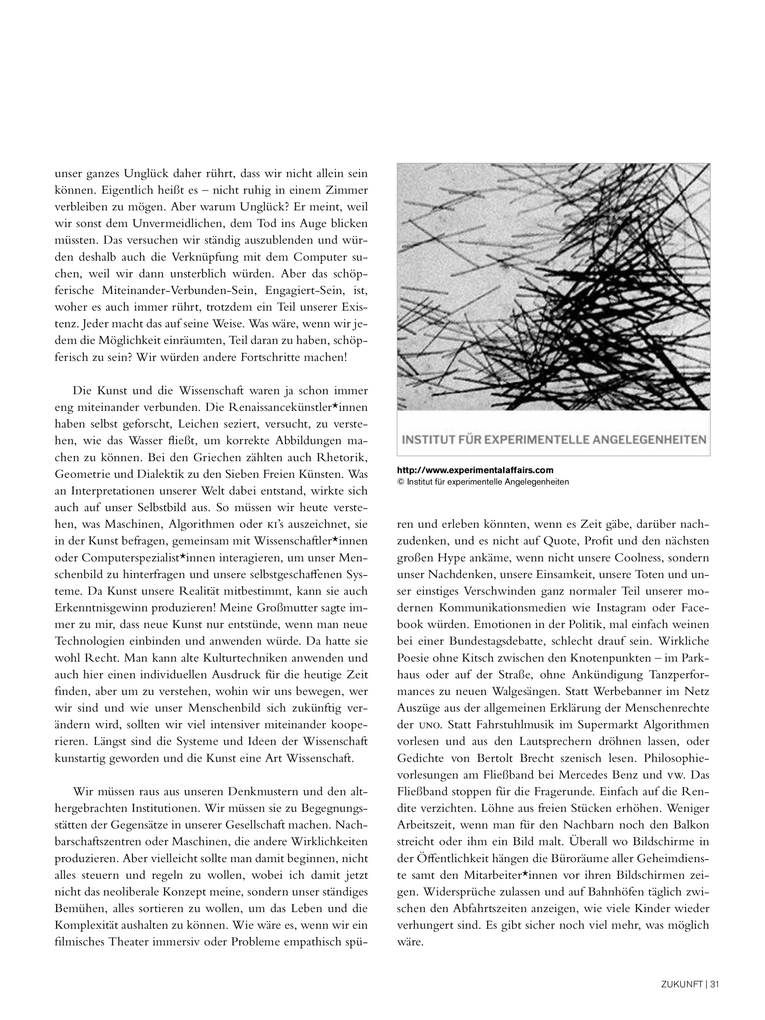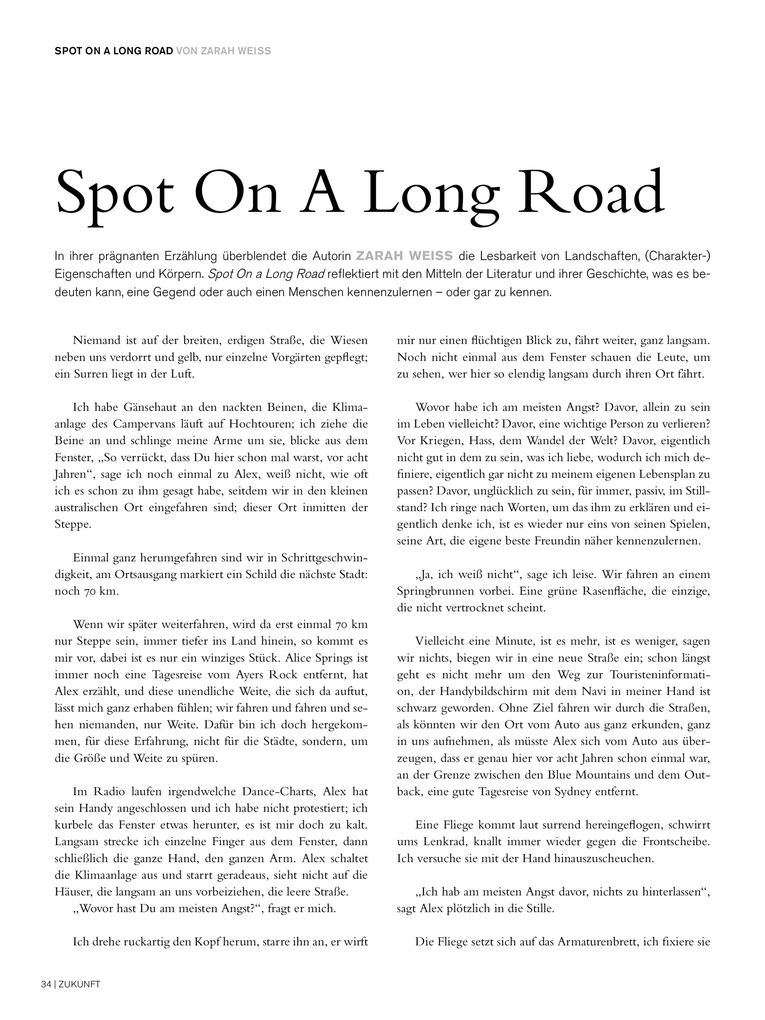30 | ZUKUNFT
MAL EINFACH WEINEN BEI EINER BUNDESTAGSDEBATTE
VON CLAUDIA LEHMANN & KONRAD HEMPEL
VI.
Am 16.03.2021 um 7.55 Uhr schrieb Konrad Hempel
Liebe Koko, die Idee alles miteinzubeziehen, die ganze
Welt künstlerisch im Raum als automatisierte selbstlernen-de Installation darzustellen, mit vielen losen Enden, die sich immer neu verbinden können, eine Installation, welche die Dinge und letztlich unsere Existenz in immer neuem Licht erscheinen lässt, ein Raum, der zu einem Objekt wird, be-stehend aus vielen Objekten und Projektionen, ein Raum, der über sich selbst hinausgeht und immer neue Räume er-schafft, bis er schließlich sein eigener Kontext wird und im-mer andere Varianten und Möglichkeiten eines Weiterlebens erschafft, eine Installation, die interaktiv das Verhalten der Besucher*innen miteinbezieht, ein filmisches Theater, wel-ches die Grenzen von Kunst, Wissenschaft, Politik, ja von uns selbst sprengt und eine unendliche Reflexion über das Sein – unabhängig von Zeit – bildet, benötigt ebenfalls unend-lich viel Zeit und geht auch nicht ohne Komplexitätsreduk-tion. Vielleicht muss es so was wie Diderots Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des mé-tiers aus dem Jahr 1751 sein – ein Mammutwerk, welches das Wissen der Welt zwischen zwei Buchdeckeln sammeln sollte. Damals war es eine Revolution, eine aufklärerische, aber was wir brauchen ist ja keine Sammlung, dafür sind die Biblio-theken und Wissensspeicher im Internet, die Server, welche mit Informationen vollgestopft sind, zuständig. Ich denke die ganze Zeit, dass so eine Installation ganz einfach sein müss-te, so wie E = mc². Einfach, schön, auf den Punkt. Das, wo-von du schreibst, klingt kompliziert. Wie soll man diese Ar-beit leisten, ohne sich zu ruinieren, wer möchte einem Geld für eine Idee geben, von der man nicht einmal weiß, was sie ist, geschweige denn, was am Ende dabei herauskommt? Ein Schwarzes Loch? Und dann die ganze prekäre Situati-on in der Kunst, alles dafür zu tun, um etwas beizutragen, nicht sinnlos seine Zeit verbracht zu haben. Wie soll man nicht profitable Projekte wie so eine Installation verwirkli-chen, wenn am Ende niemand erkennt, was man da versucht hat? Wir haben das ja schon oft getan – aus Notwendigkeit, wie wir glaubten. Ich bleibe unserer Gesellschaft gegenüber skeptisch.
Ahoi von meinem sonnenbeschienenen Schreibtisch, K.
VII.
Am 17.03.2021 um 12.32 Uhr schrieb Claudia Lehmann
Lieber K., wenn wir uns schon ruinieren, dann müssen
wir in Zukunft eben besser dafür sorgen, dass man auch sehen kann, wofür wir uns ruiniert haben. Im besten Fall für einen Ausdruck von Wahrheit! Für dieses Vorhaben müssen wir Al-gorithmen erfinden. Ich kann leider nicht so gut program-mieren. Wir müssen gemeinsam Leonardo da Vinci werden, und wenn wir das in persona nicht sein können, müssen wir gleichberechtigt in Teams zusammenarbeiten. Wir beide wis-sen schon zu gut, dass das nicht immer ganz einfach ist. Trotz-dem will ich an dem Gedanken festhalten! Wir expandieren über die Kunst hinaus! Wir brauchen Programmierer*innen, Hirnforscher*innen, Techniker*innen, Handwerker*innen, Landwirt*innen, Ingenieur*innen und viele mehr, so dass auch alles Nachdenken und Verknüpfen, das Abarbeiten an der Wirklichkeit, um die Wirklichkeit eben vor uns her-zutreiben, überall zugänglich gemacht und gesehen werden kann! Wir ruinieren uns dann gemeinsam. Oder wir schaf-fen es endlich, dass wir es uns leisten können, umsonst zu ar-beiten. Oder ist es besser, wenn man als Künstler*in etwas leidet?
Ich könnte ja einen anderen Job machen, zum Beispiel ei-
nen Tatort drehen. So erreiche ich in jedem Fall eine Menge Leute und ich könnte mir sogar eine(n) Babysitter*in leisten. Eine Leiche in einem Sonntagsabendkrimi perfekt in Szene zu setzen, will aber gerade nicht so richtig zu meiner Visi-on und diesem allumfassenden Projekt oder Experiment oder ‚unfinished process‘ passen, das alle bisherigen Formate über-winden muss. Wir suchen doch nach einem künstlerischen Ausdruck. Die Produktionsweisen und die Finanzierungs-modelle müssen dafür reformiert werden. Wir brauchen ein Oberhausener Manifest, eine Nouvelle Vague, ein Free Ci-nema, ein Free Theatre, ein Dogma 95, ein Dogma 20_13, Dogma 2022. Vielleicht schreiben wir das erst mal auf.
Mit nachdenklichem Gruß, Koko
VIII.
Am 17.03.2021 um 22.01 Uhr schrieb Konrad Hempel
Koko, du hast natürlich recht, wenn du sagst, dass man
sich engagieren muss, weil es sonst wahnsinnig leise um uns herum wird und auch langweilig. Es liegt wohl auch in der Natur der Menschen, schöpferisch zu sein, und das in Bezie-hung mit anderen. Gestern habe ich mir ein Interview mit Heiner Müller angesehen. Er hat Pascal zitiert, der sagt, dass