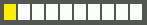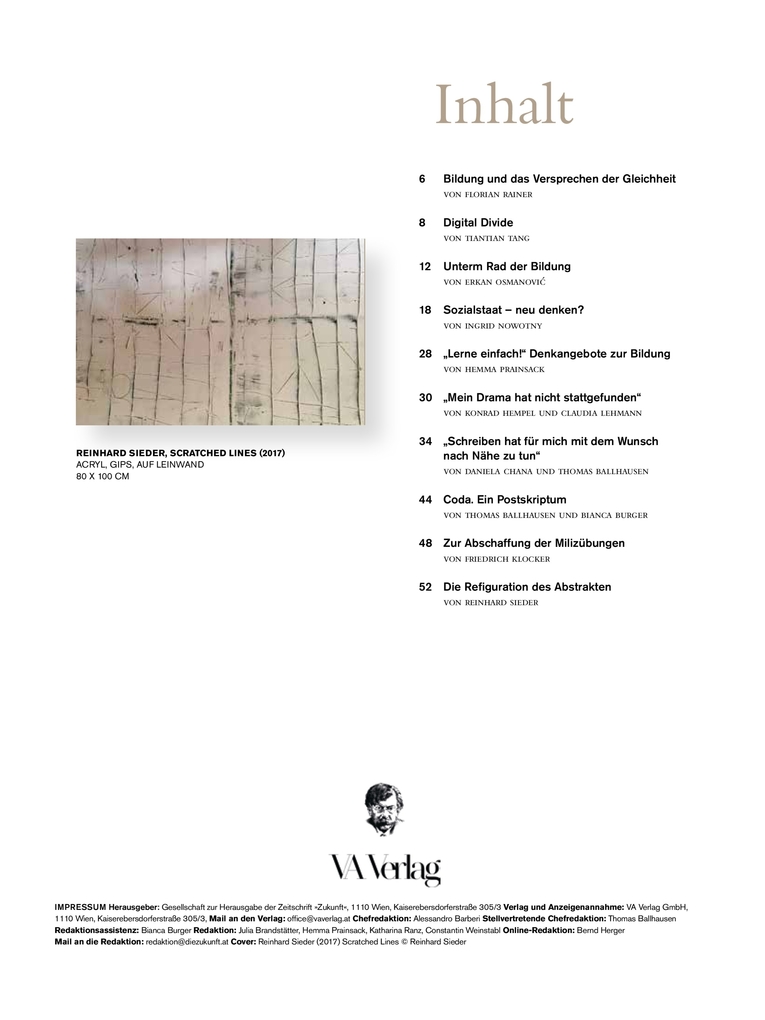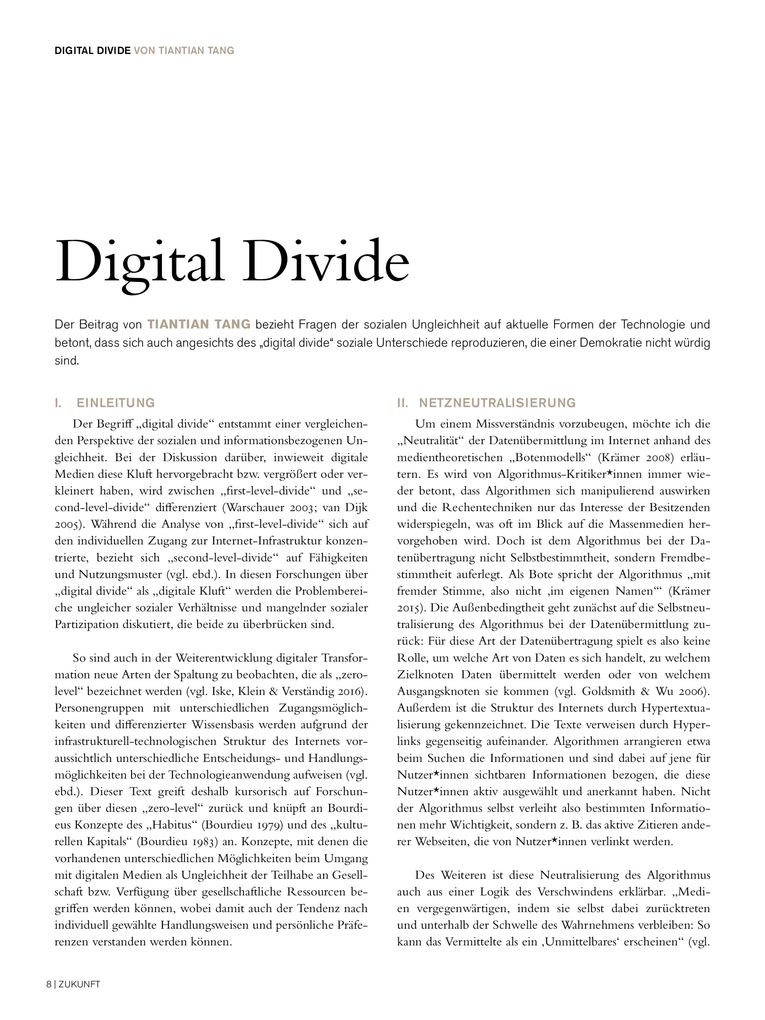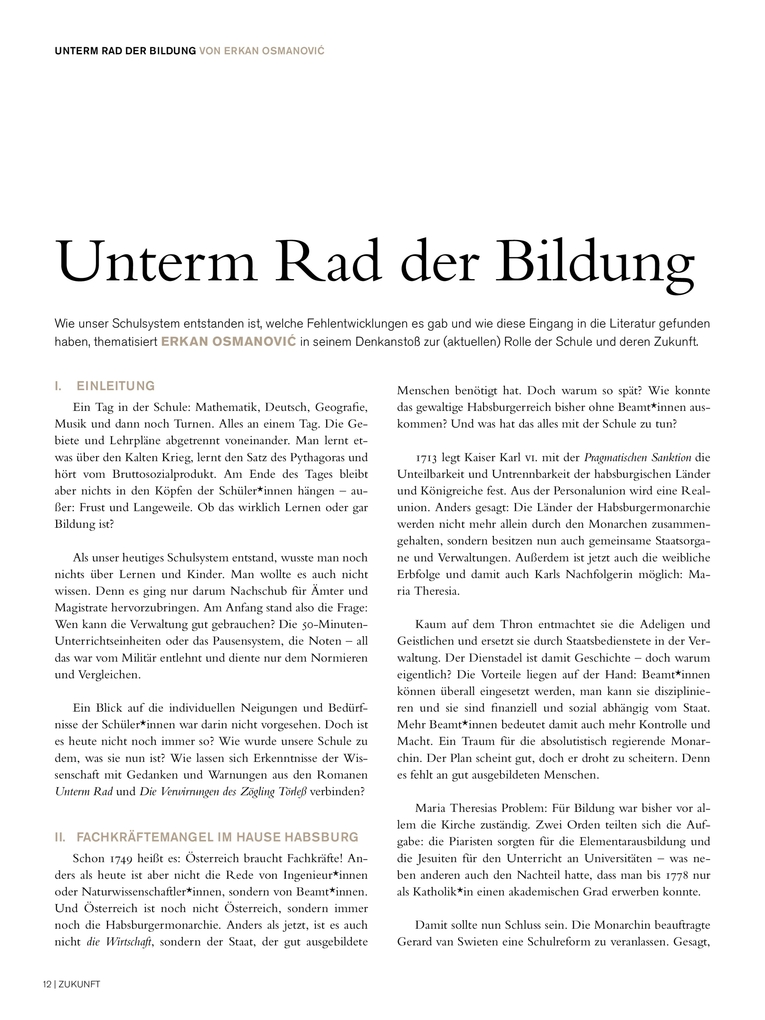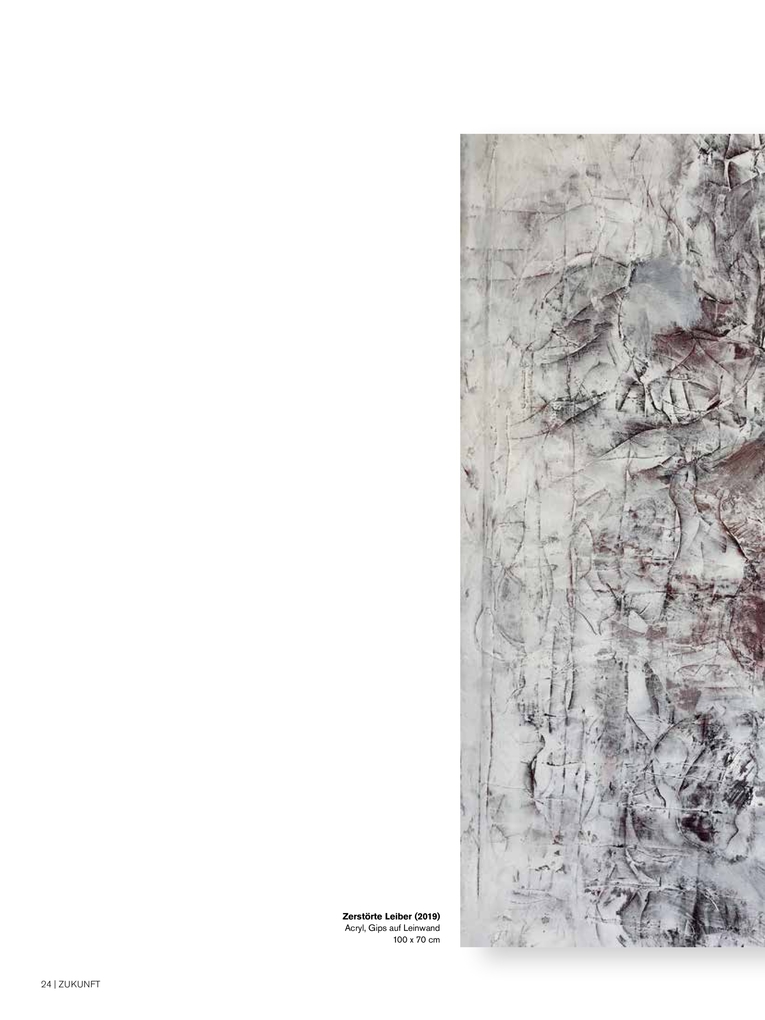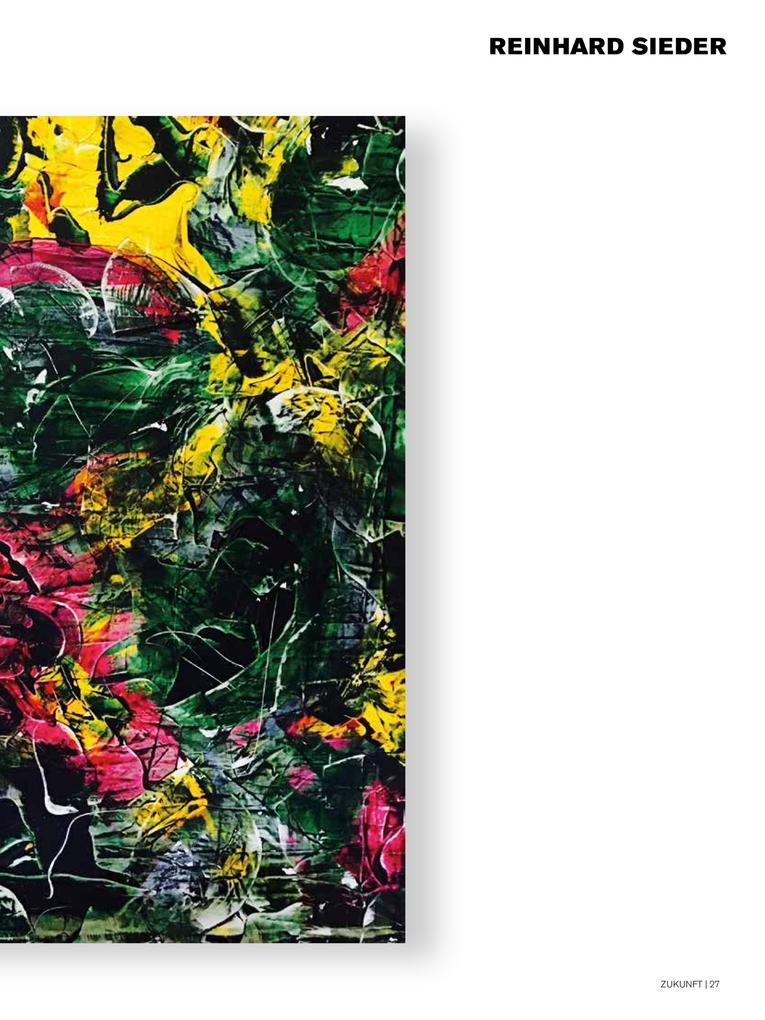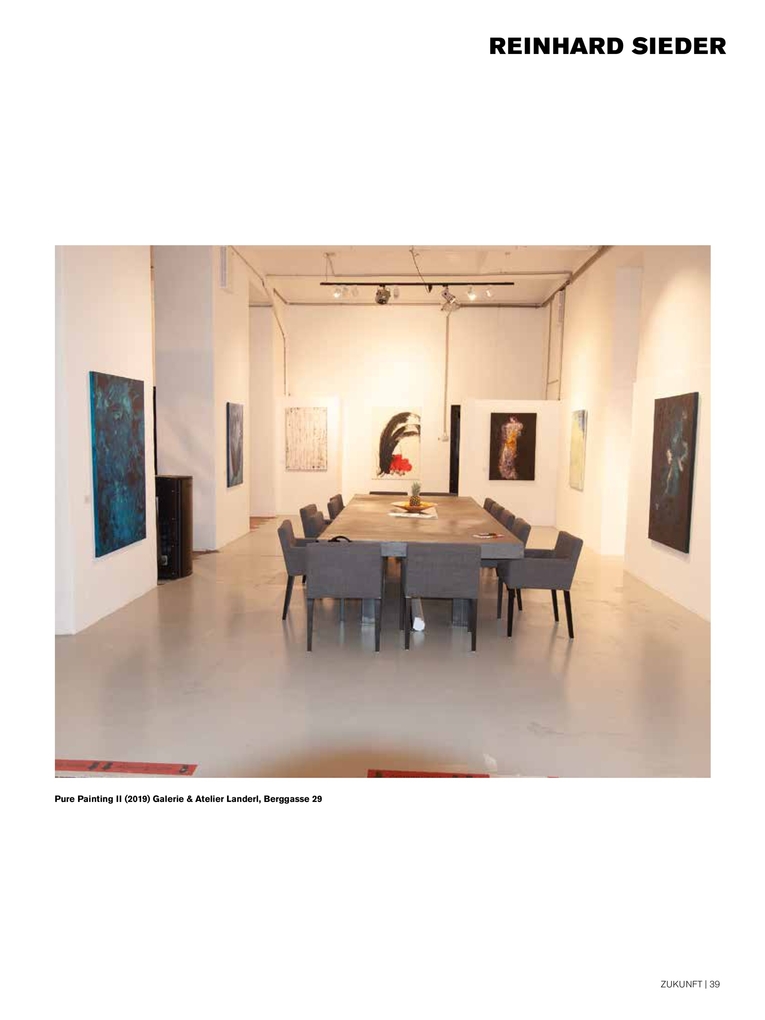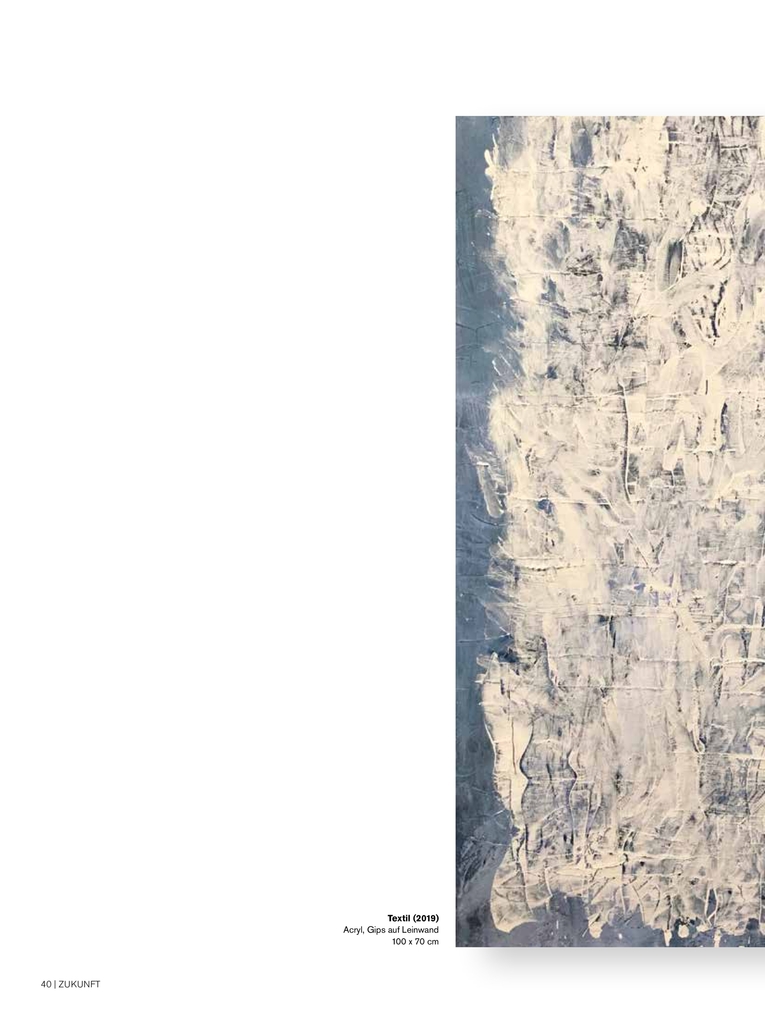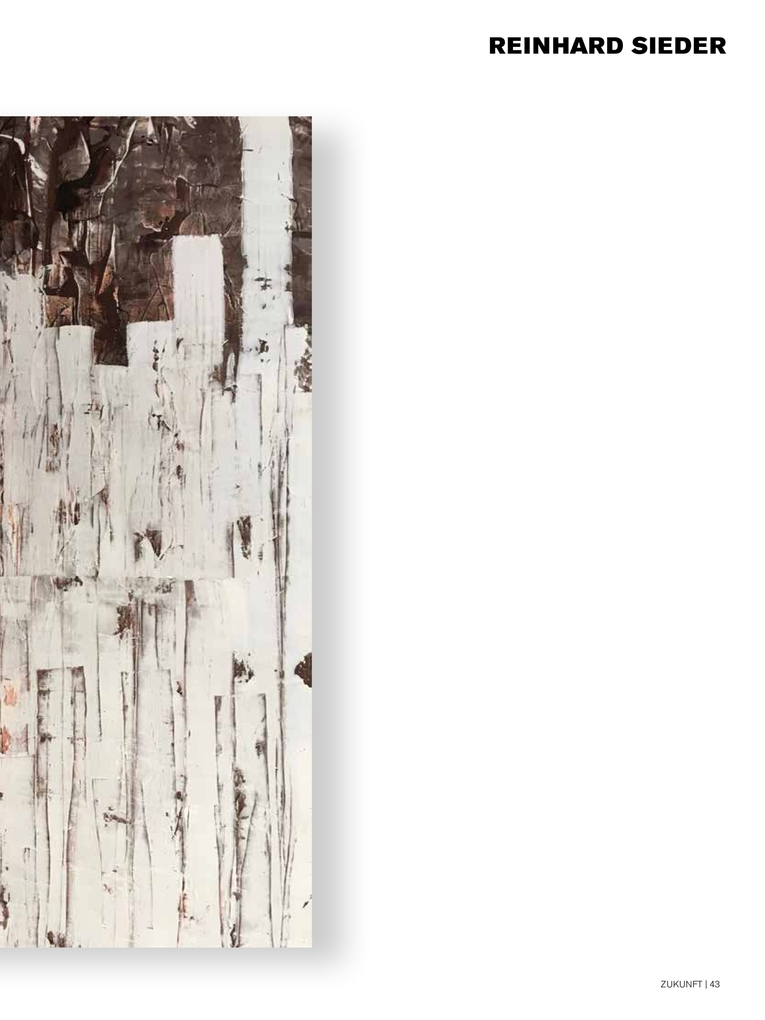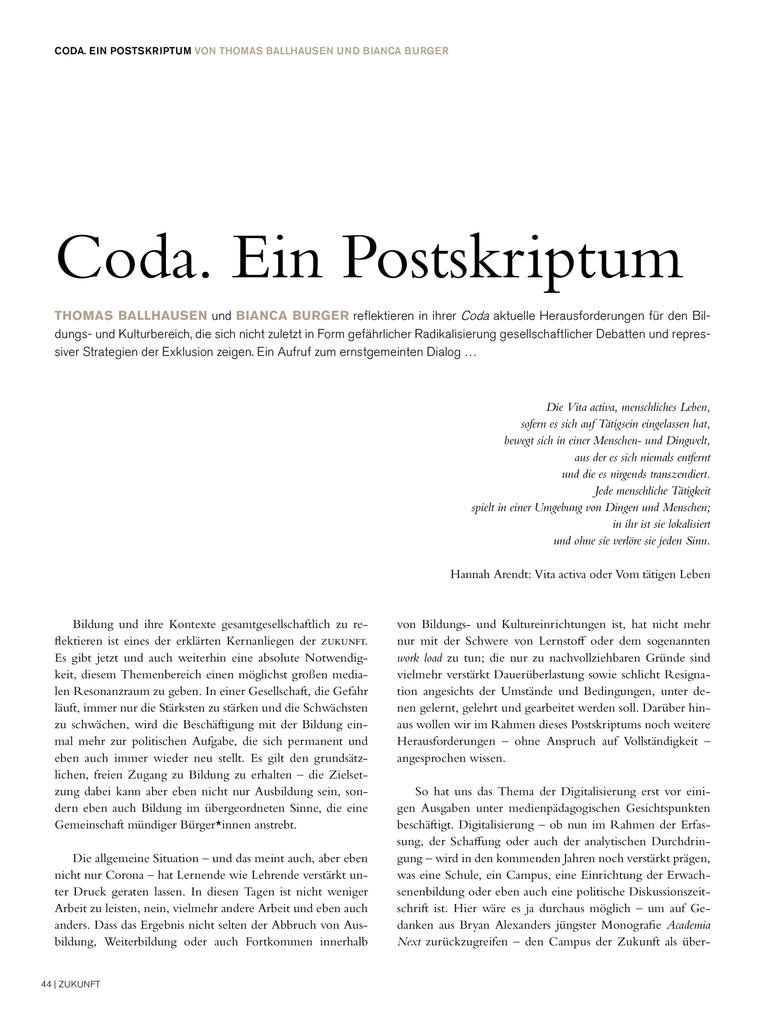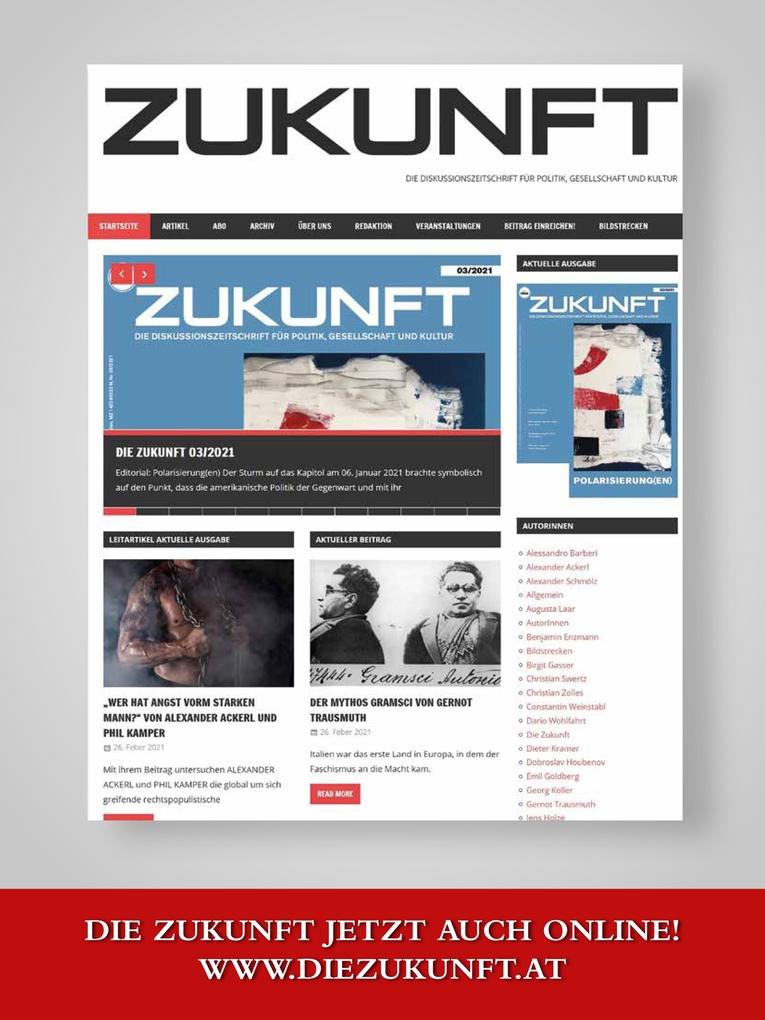ZUKUNFT | 37
VI. TEXTAUSSCHNITT THÁLEIA (KOMÖDIE)
Ich hatte meine eigene Kammer abseits des Geschehens,
ein bisschen wie eine Souffleuse im Theater. Jeden Abend kam der Chefkoch für ein paar Sekunden zu mir in die Kammer, um sich auszuschnaufen. Wenn er vor Zorn richtig getobt hatte und die schwierigsten Gänge endlich hinausgeschickt waren, versteckte er sich für eine Weile hinter der Wand ne-ben dem Spülbecken. Ohne mich zu beachten, schloss er die Augen und atmete tief durch. Dann nahm er stets eine kleine Schnapsflasche aus seiner Kochjacke und trank einen ordentli-chen Schluck, während ich zwei Meter neben ihm stand, mit dem Schwamm in der Hand. Anfangs schämte ich mich. Ich hielt den Atem an und traute mich kaum mehr, meine Hand im Spülbecken zu bewegen und ein Geräusch zu machen, weil ich erwartete, dass er plötzlich die Augen öffnen, mich ansehen und dann anschreien würde, weil ich Zeugin seiner schwächsten und verletzlichsten Sekunden geworden war. Erst nach einigen Wochen, nachdem sich das Spiel fünfzehn oder zwanzig Mal wiederholt hatte, begriff ich, dass der Koch mei-ne Anwesenheit ignorierte, weil ich für ihn keine Bedeutung hatte. Ich war niemand, für den es sich lohnte herumzuschrei-en oder Pfannen und Töpfe auf den Boden zu werfen. Es gab keine Leistung, die mir ein Gesicht verlieh. Ich erfand keine genialen Saucen, an denen man meine Persönlichkeit able-sen konnte, oder dekorierte Teller in einer unverwechselbaren Handschrift. Es gab keinen Geschmack oder kein Gewürz, das man mir zuordnen konnte, sondern nur einen Stapel sauberer Teller, Gläser und Tassen, die darauf warteten, wie ein leeres Blatt Papier von jemand anderem beschrieben zu werden. Ich war für das ständige Löschen zuständig und für das Bereitstel-len, mein Job war nur ein Platzschaffen für andere.
Nachdem ich das begriffen hatte, fiel es mir weniger
schwer, mit diesen intimen Momenten des Kochs umzuge-hen. Während er neben mir stand und durchatmete und sei-nen Schnaps trank, klapperte ich weiter mit den Tellern und Gläsern im Spülbecken und täuschte meinerseits vor, ihn zu ignorieren. Es war ja auch nichts Besonderes, dass er trank. In der Küche tranken alle die ganze Zeit. Alle tranken den Wein, der für die Saucen verwendet wurde, sodass man ständig fluchte, die Flasche sei schon wieder leer. Hemmungslos wur-de mitunter sogar der teure Wein aufgemacht, der für die Gäste bestimmt war, und dann irgendwo in der Buchhaltung falsch eingetragen. Ganz co-abhängig hielt die gesamte Küchencrew beim Lügen zusammen, damit fehlender Alkohol nicht auffiel. Die Kellner tranken sogar die Reste aus den Weingläsern, die von Restaurantgästen zurückgeschickt wurden.
VII.
T.B.: Deine Erzählungen bestechen nicht zuletzt durch
eine Aufwertung des Alltags, der als eine Form von Abenteuer erfahrbar wird. Du schreibst über Routinen und Sicherheiten – auf eine einnehmende, nicht selten sehr humorvolle Weise. Siehst Du da eine Herausforderung und Aufgabe für Dich als Autorin? Berühren sich auch auf dieser Ebene Deine bisher erschienenen Veröffentlichungen, vielleicht sogar Deine aktu-ellen und künftigen Projekte?
D.C.: Es gibt doch nichts Spannenderes als den Alltag an-
derer Leute! Meine Lieblingsszenen in Filmen sind auch im-mer die, in denen jemand bügelt oder die Wäsche aufhängt oder beim Frühstück eine Zeitung liest. Wenn hingegen je-mandem ein Abenteuer passiert, schlafe ich immer vor Lan-geweile ein – das ist mir zu weit weg vom Leben. Meiner Lektorin ist einmal aufgefallen, dass in fast jedem meiner Tex-te irgendjemand das Geschirr abwäscht. Mich interessiert, wie Menschen den Alltag bewältigen, die ganz gewöhnli-chen Dinge, die doch insgesamt alle schwierig und abenteu-erlich genug sind. Schreiben hat für mich sehr stark mit dem Wunsch nach Nähe zu tun. Ich möchte jemandem nahe sein, also mache ich daraus eine literarische Figur und folge ihr in ihren Alltag, bis ich sie besser kenne als irgendjemanden sonst. Das wird wahrscheinlich immer mein Zugang zum Schrei-ben sein. So war es schon bei Sagt die Dame und bei allen Tex-ten von mir, die in Zeitschriften oder Anthologien erschienen sind. Aktuell arbeite ich an einem Roman, und auch hier war der Ausgangspunkt, dass ich gewisse Figuren und Beziehungs-konstellationen näher kennenlernen wollte: Was kochen sie, was sagen sie einander vor dem Schlafengehen, wie verhalten sie sich in bestimmten Situationen?
VIII.
T.B.: Diese Einblicke in Deine Poetik erinnern auch an
das vieldiskutierte Feld eines weiblichen Schreibens, wobei das ja, was nicht vergessen werden darf, nicht einfach eine eindeu-tig geschlechtliche Zuordnung meint. Wie ist Dein Verhältnis zum weiblichen Schreiben als Autorin, aber auch als Leserin oder Literaturwissenschaftlerin? In Deinen Interessen kom-men ja so unterschiedliche Positionen wie Tori Amos oder Shirley Jackson zusammen.
D.C.: Ich bin nicht der Typ, der sich an aufgeregten De-
batten beteiligt. Viel lieber orientiere ich mich an positiven Vorbildern, von denen ich immer viele gefunden habe, und