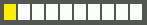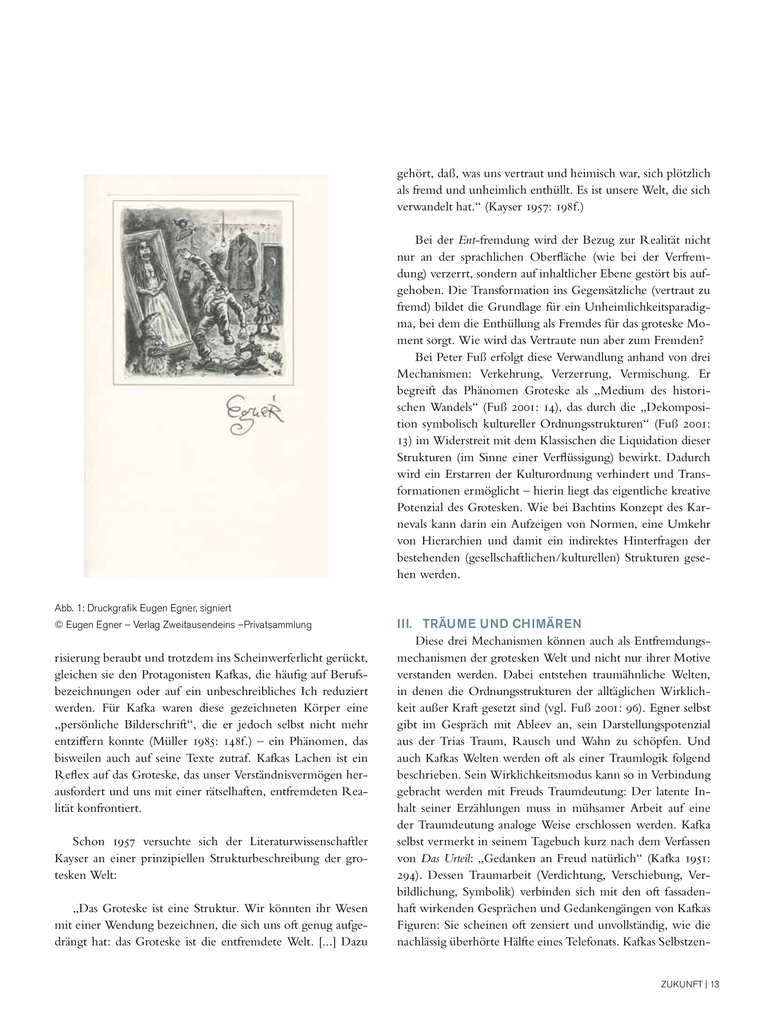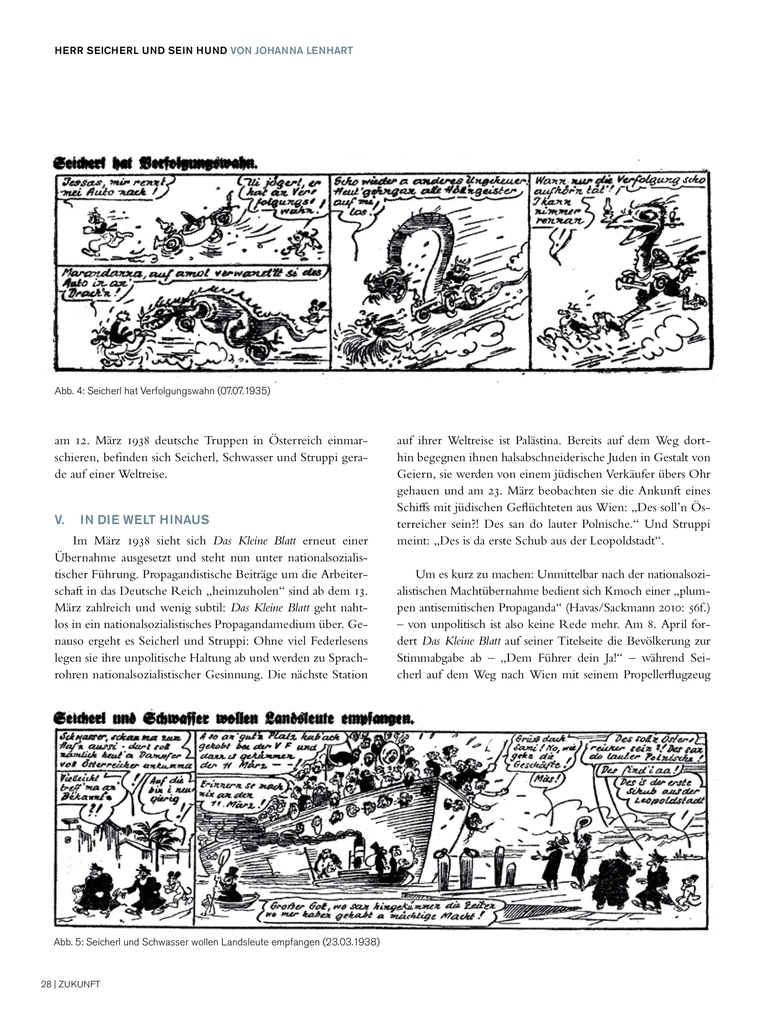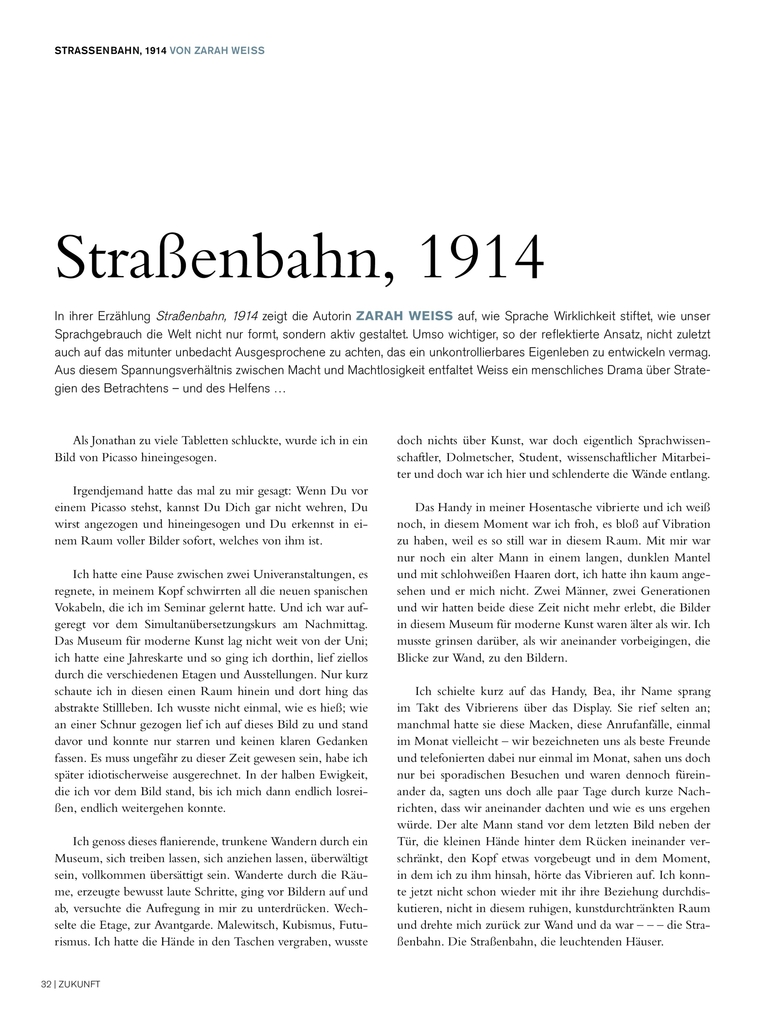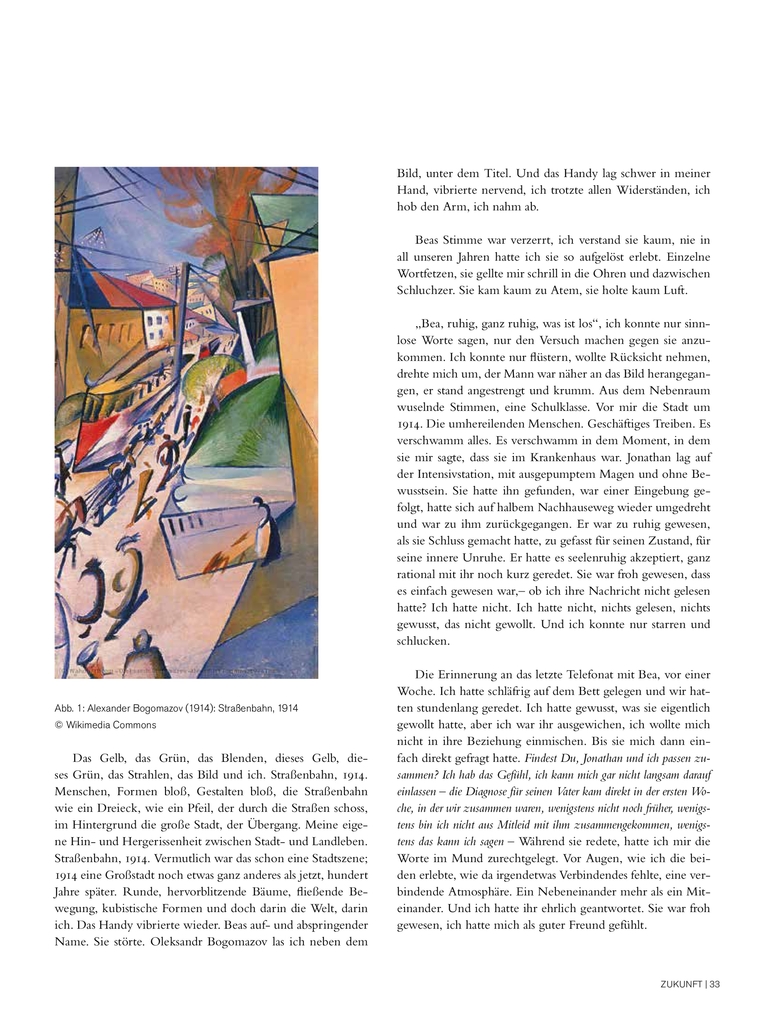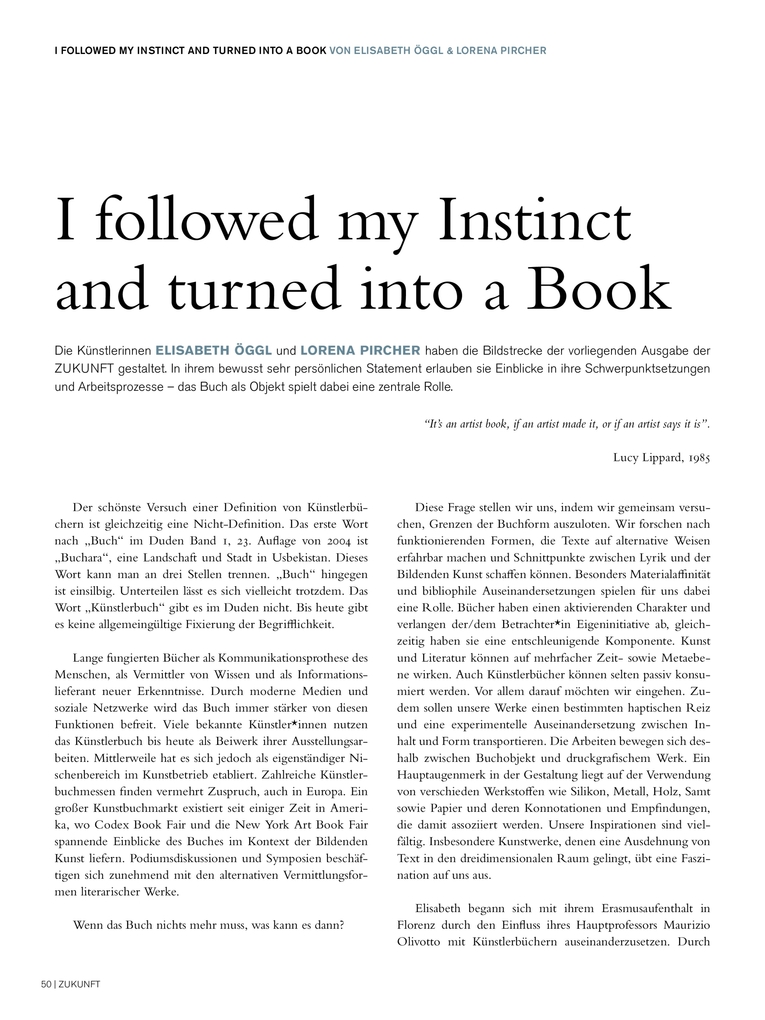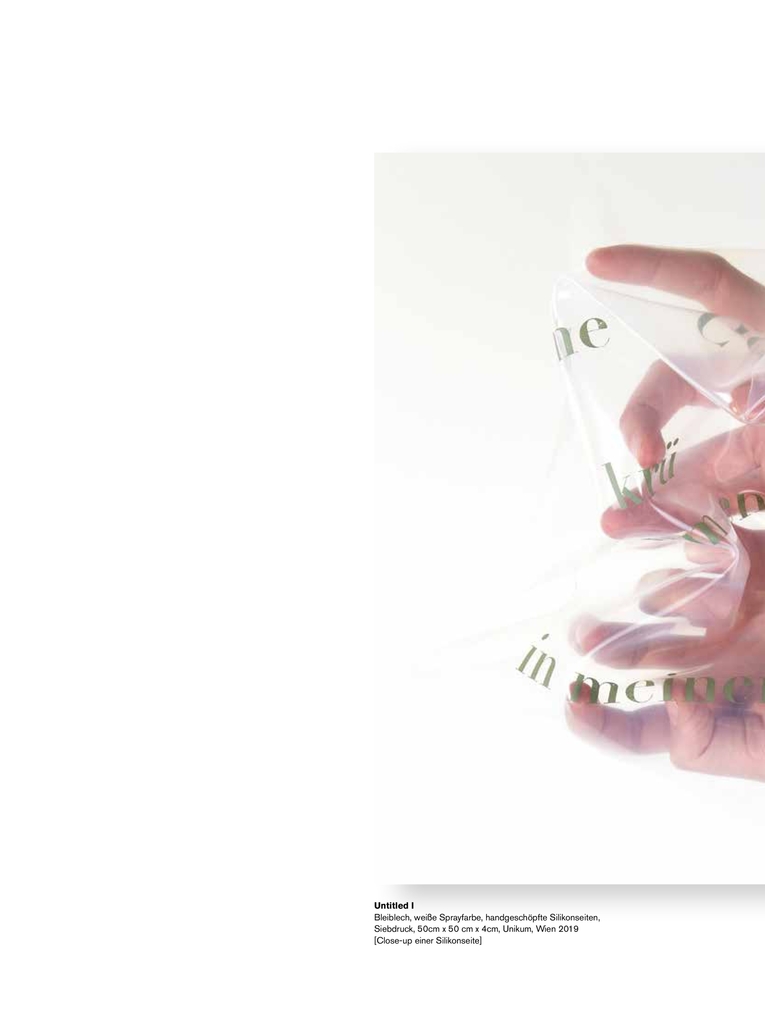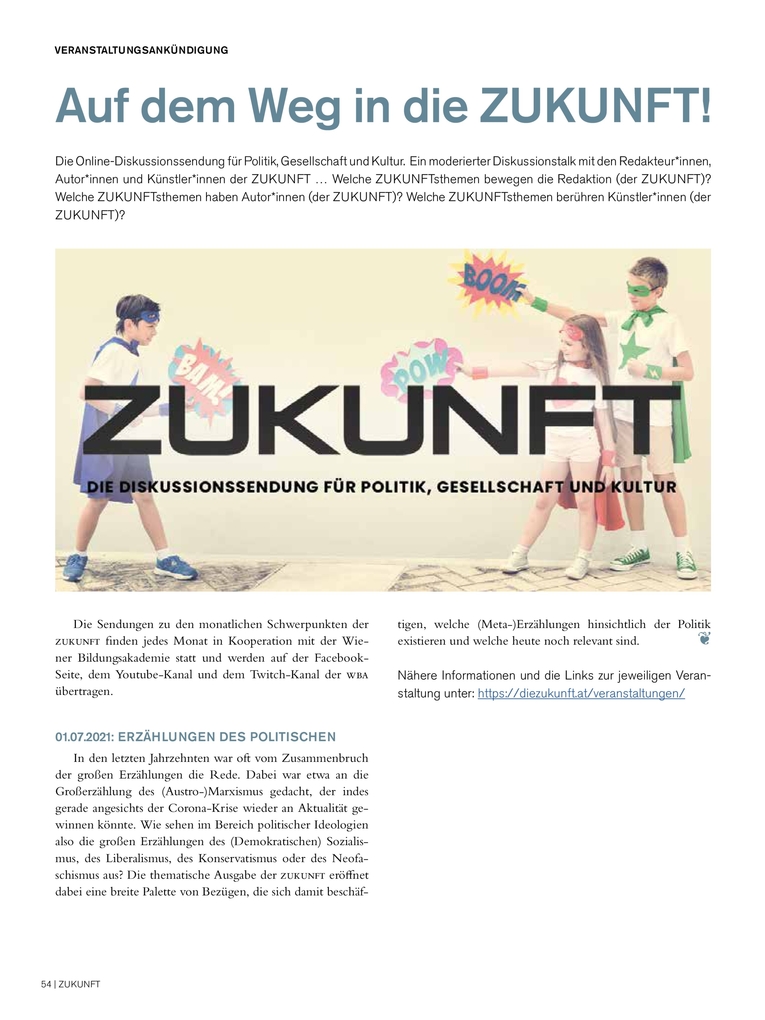ZUKUNFT | 21
sammengetragenen Trümmern werde ich nach und nach ein solides Fundament fertigen, auf dem ich stehen kann. Aber ich werde in dieser individuellen Historie darauf verzichten, über die Stadt und ihre Türme zu schreiben. Alle relevan-ten Dinge über sie sind schon gesagt worden, es erscheint mir deshalb sinnlos, diese ohnehin bekannten Umstände zu wie-derholen oder ihnen unbestätigte Gerüchte hinzuzufügen. Ich belasse es bei dem Hinweis, dass wir beide doch ohnehin wis-sen, was passierte und warum ich, wie viele andere auch, da-nach lange Zeit nicht richtig schlafen konnte.
Ich versuche es also mit diesem Text, auch wenn schon
jetzt, mit den ersten Zeilen, klar ist, dass ich hinter dieser ei-genartigen, dieser schrecklichen und wunderbaren Zeit nur zurückbleiben kann, dass die Worte nur einen Abglanz von dem bieten können, was ich glaube damals empfunden zu ha-ben. In diesen letzten, in diesen verletzten Kindertagen sind wir auf das Zwielicht eines neuen Alters zugestolpert, näher-ten wir uns unbekannten Fallstricken, dem ohnehin unver-meidlichen Verlust. Hinter manche Punkte kann man nicht zurückgehen, aber es gibt noch ein herrliches, letztes Auf-bäumen, bevor alles vergeht. Die erschreckende Endgültig-keit dieses Umstands ist uns schlicht nicht immer sofort be-wusst. Ich war jünger damals, viel jünger, wirklich jung sogar und ich hatte es geschafft, vom allgegenwärtigen Krieg mög-lichst unbeeindruckt zu bleiben. Die letzte Phase eines Kon-flikts, die, was wir nicht wissen konnten, nur wenige Wochen dauern sollte, brachte mit einer kaum zu verstehenden Ge-schwindigkeit Umwälzungen mit sich, die wir nicht erahnten. Es waren andere Tage, eine Zeit, in der ich ein gänzlich ande-rer Mensch war, niemand, in dem Du mich wiedererkennen würdest. Natürlich war ich vorbelastet, ich war in diesen Brei-tengraden des Pflichtbewusstseins und der Willfährigkeit ge-boren worden. Es waren Zustände, über die sich nicht mehr – wie es so schön verschleiernd heißt – vernünftig sprechen lässt.
Das alte Haus am Ende der Straße, das Van-Doren-An-
wesen, war in meiner Erinnerung immer schon unbewohnt gewesen. Als wir in das Gebäude einbrachen, fanden wir es beinahe leer vor. Einbauschränke und eine stehen gebliebe-ne Wanduhr waren noch da, in manchen Ecken standen vom Regen aufgeweichte Zeitungsstapel herum. Die Tapeten wa-ren stellenweise aufgeplatzt und man konnte die darunter lie-genden, alten Ziegel sehen. Umrisse an den Wänden zeigten an, wo die Bilder gehangen, hellere Flächen auf dem hölzer-nen Boden, wo die Möbel gestanden hatten. In den ersten
Tagen unserer Besetzung, unserer Inbesitznahme hatten wir uns kaum getraut, über diese deutlich sichtbaren Grenzen zu treten. Es war so, als wären die Gegenstände noch dort, als könnte man noch auf einem bequemen Sofa Platz nehmen, ein teures Gemälde betrachten, sich an einen reich gedeckten Tisch setzen oder sich in einem viel zu großen Bett wälzen. Das Gebäude erwies sich als Gehäuse für uns, das eben durch seine Begrenztheit eine unerwartete Sicherheit und Freiheit gewährte. In diesem rechtsfreien Raum abseits aller gesell-schaftlichen Ordnungen konnten wir etwas verlangen, etwas bekommen. Die Gerüchte über die letzten Besitzer reichten uns als Erklärungen, das Minimum ungesicherter Informati-onen und getuschelter Geheimnisse war uns genug. Wir ver-steckten dort, was wir auf den Strassen fanden, was wir in den Läden stahlen oder aus den vergleichsweise ärmlichen Häu-sern unserer Eltern schmuggelten. In diesem Sommer des Übergangs bevölkerten wir das Haus und trugen in der durch die Hitze bedingten Langsamkeit die Objekte unserer gar nicht so unschuldigen Begierden zusammen. Dieses alte Haus wurde unser Projekt, unsere Aufgabe und Ablenkung. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sie gesucht hatten, wichtiger war bestimmt, dass wir sie gefunden hatten. Mit diesen Räumen ging eine Spielfreude abseits aller Normen, aller Abzählreime und der Anzahl gewürfelter Augen einher. Alles was wir uns vorstellen konnten, wurde Bestandteil dieser neuen Welt. Wir tranken Feuer als gäbe es kein Morgen und waren so furcht-los gebieterisch wie möglich. Manche der zahlreichen Räume durften nur auf bestimmten Pfaden durchschritten werden. Es war eine morsche Welt. Wohin wir uns auch wandten, wir wurden vom knarrenden Geräusch des nachgebenden Bo-dens ständig begleitet. Ein neues Regime entstand in diesen Mauern, die leeren Zimmer wurden zu den Projektionsflä-chen unserer Wünsche. Die neue Wirklichkeit verstreuten wir wie Farbe an den uns umgebenden Wänden, wir brachten die Spuren einer neuen Herrschaft, unserer Herrschaft, an. Wir verwandelten uns in die Helden der damals so populä-ren TV-Serien, der als Schundhefte verschrieenen Abenteuer-romane und der billigen Comichefte, deren Druckerschwärze an unseren Händen klebte. Mit dem Betreten des Gebäudes schlüpften wir in unsere Rollen, in neue Verkleidungen und Verbindlichkeiten. Es war fast schon überraschend, wie gut al-les funktioniert hat, wie wenig Worte notwendig waren, um neue Familien zu erschaffen. Besucher waren in der gemein-samen Fiktion nicht willkommen, in unserem Verständnis war das Haus schon voll. Niemand sonst hätte sich, so unsere un-ausgesprochene Überzeugung, in unser System eingefügt, in all die gestohlenen Gegenstände, die entlehnten Erzählungen,