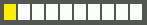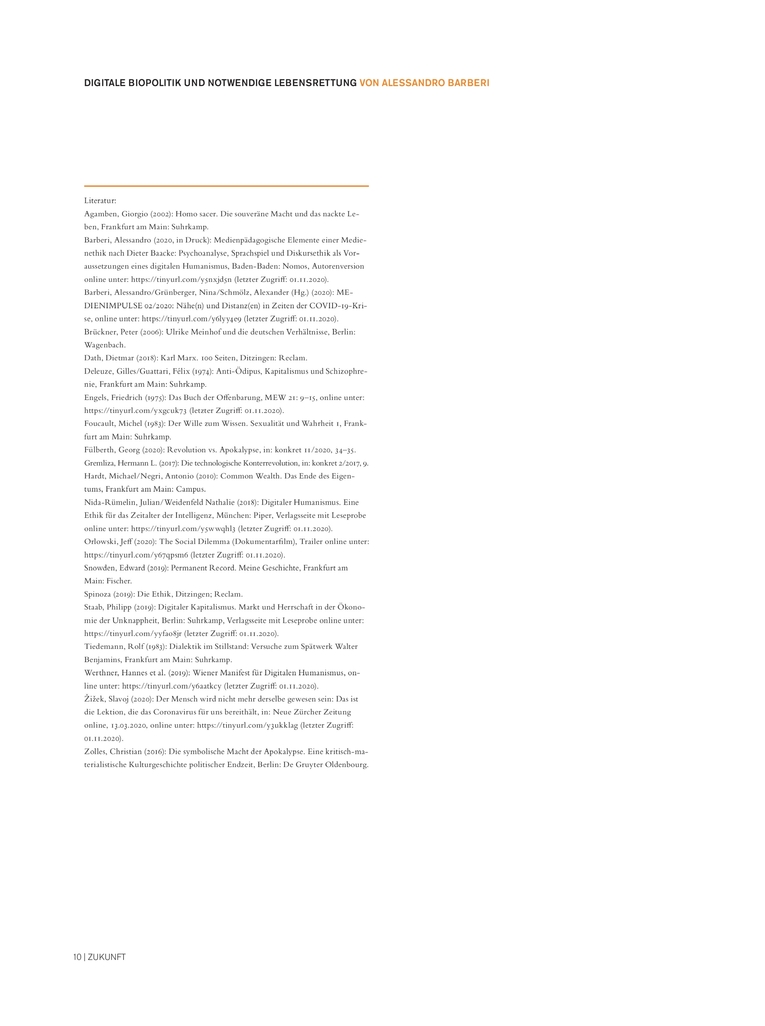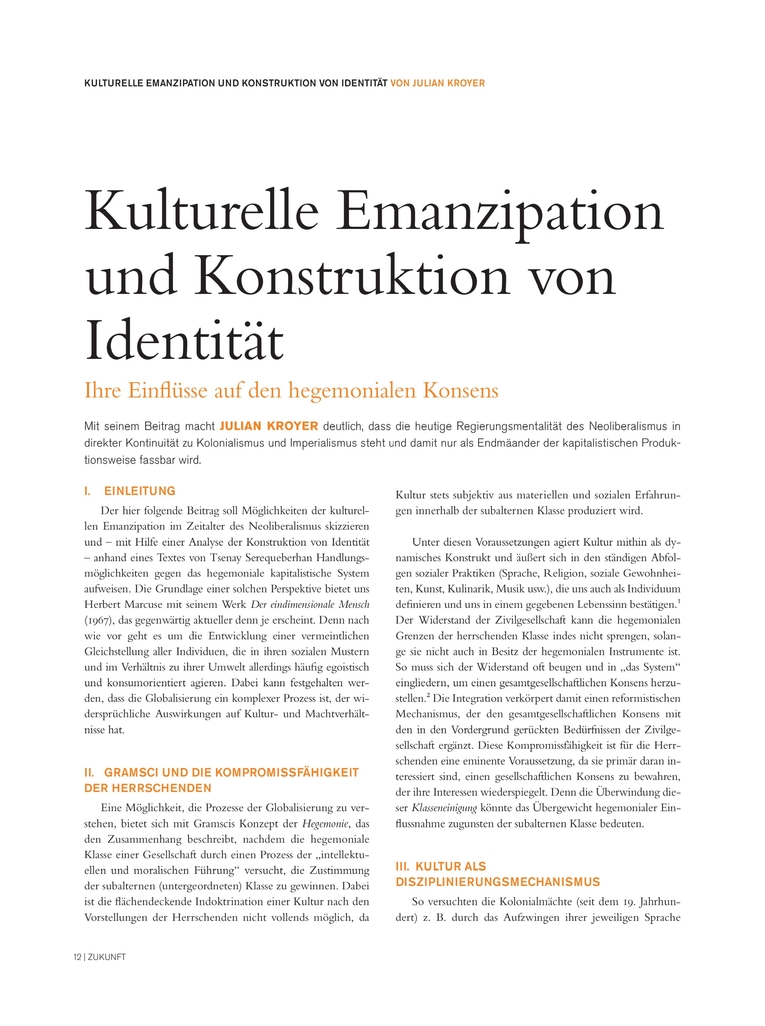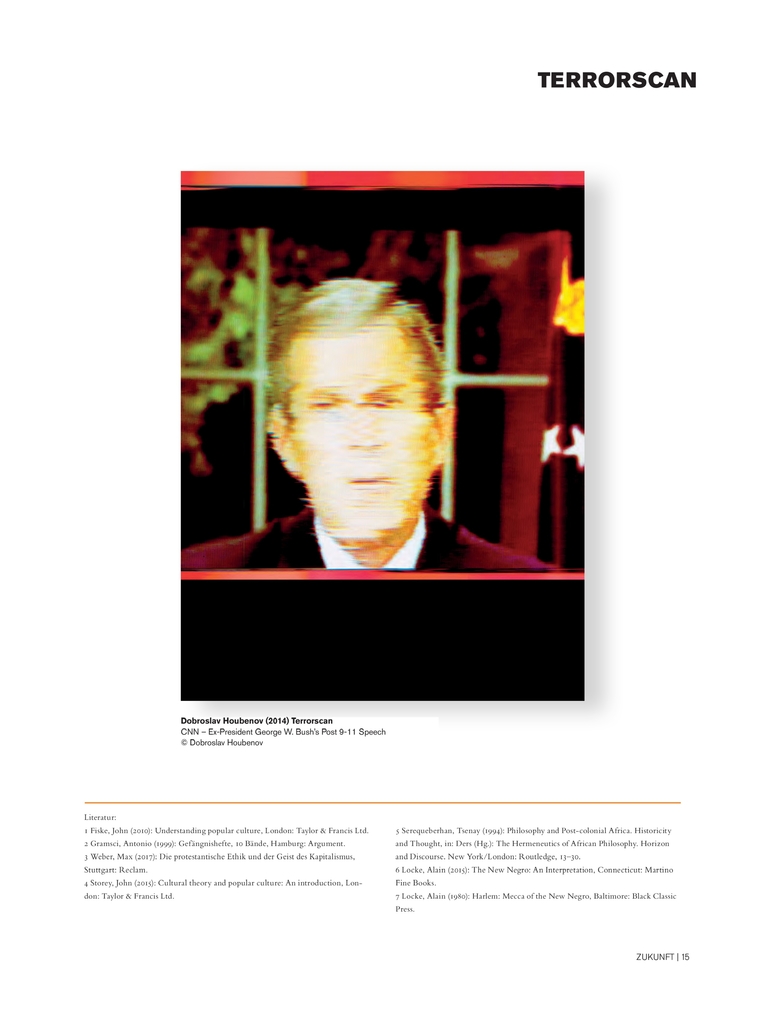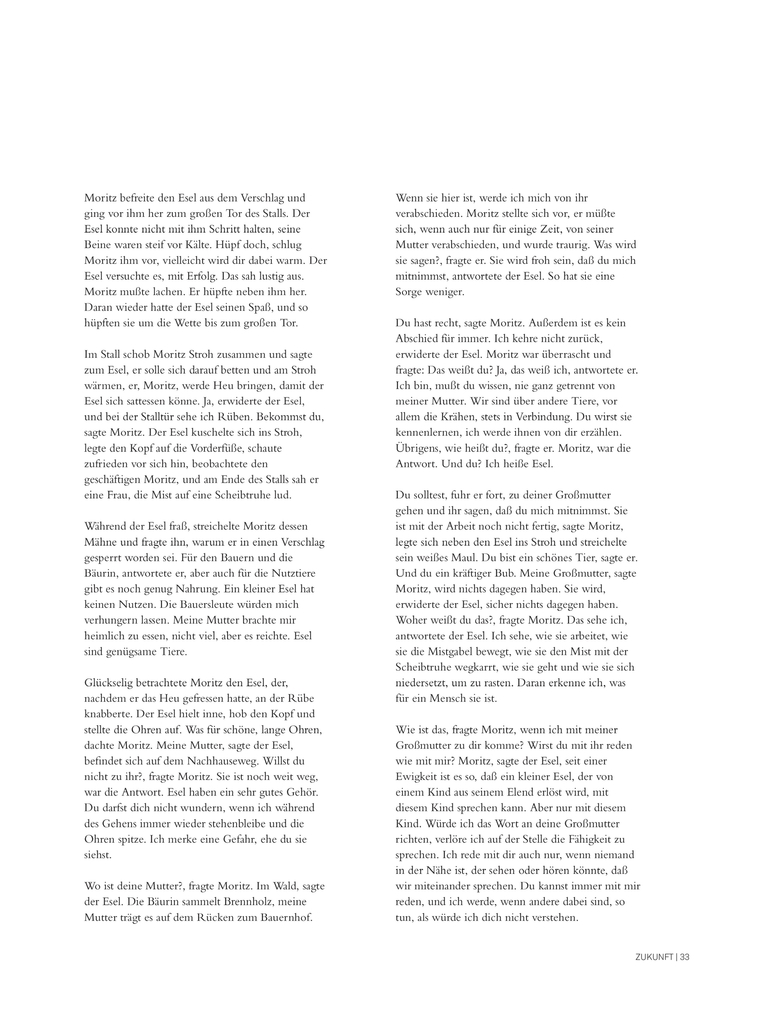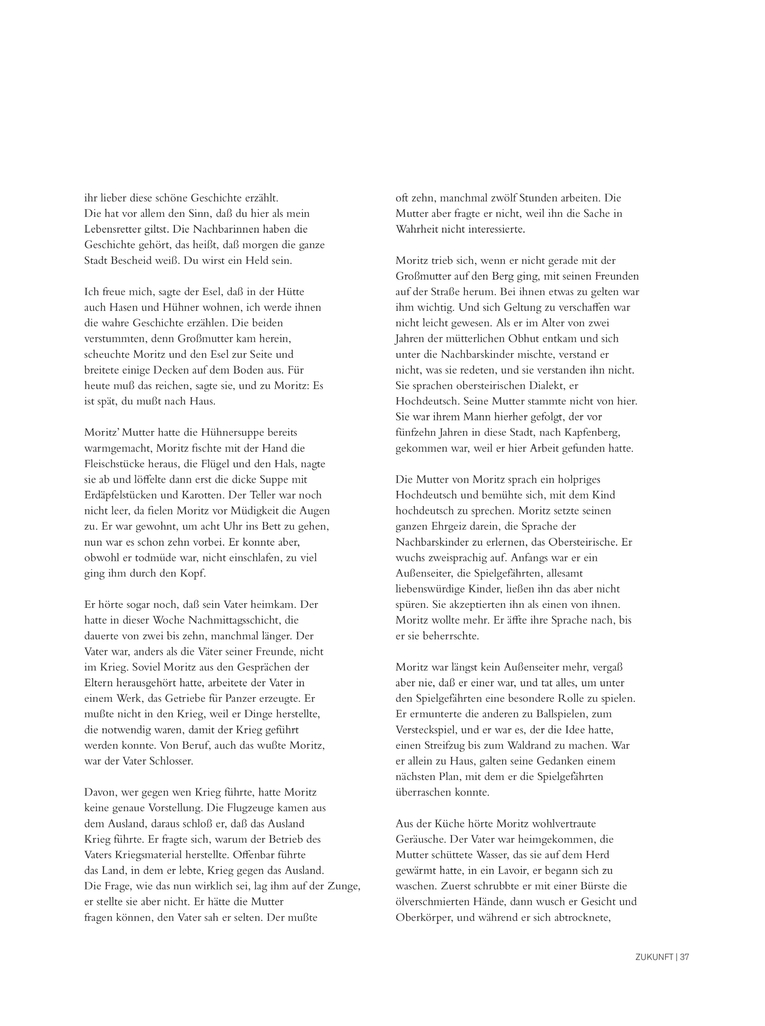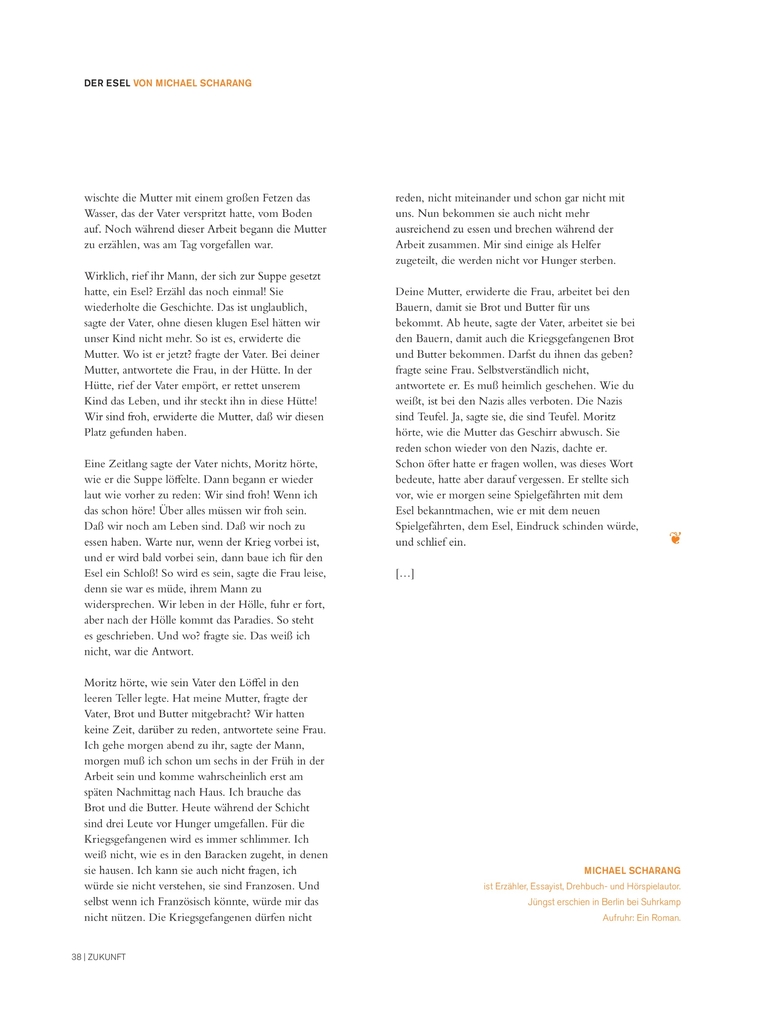ZUKUNFT | 33 Moritz befreite den Esel aus dem Verschlag undging vor ihm her zum großen Tor des Stalls. DerEsel konnte nicht mit ihm Schritt halten, seineBeine waren steif vor Kälte. Hüpf doch, schlugMoritz ihm vor, vielleicht wird dir dabei warm. DerEsel versuchte es, mit Erfolg. Das sah lustig aus.Moritz mußte lachen. Er hüpfte neben ihm her.Daran wieder hatte der Esel seinen Spaß, und sohüpften sie um die Wette bis zum großen Tor.Im Stall schob Moritz Stroh zusammen und sagtezum Esel, er solle sich darauf betten und am Strohwärmen, er, Moritz, werde Heu bringen, damit derEsel sich sattessen könne. Ja, erwiderte der Esel,und bei der Stalltür sehe ich Rüben. Bekommst du,sagte Moritz. Der Esel kuschelte sich ins Stroh,legte den Kopf auf die Vorderfüße, schautezufrieden vor sich hin, beobachtete dengeschäftigen Moritz, und am Ende des Stalls sah ereine Frau, die Mist auf eine Scheibtruhe lud.Während der Esel fraß, streichelte Moritz dessenMähne und fragte ihn, warum er in einen Verschlaggesperrt worden sei. Für den Bauern und dieBäurin, antwortete er, aber auch für die Nutztieregibt es noch genug Nahrung. Ein kleiner Esel hatkeinen Nutzen. Die Bauersleute würden michverhungern lassen. Meine Mutter brachte mirheimlich zu essen, nicht viel, aber es reichte. Eselsind genügsame Tiere.Glückselig betrachtete Moritz den Esel, der,nachdem er das Heu gefressen hatte, an der Rübeknabberte. Der Esel hielt inne, hob den Kopf undstellte die Ohren auf. Was für schöne, lange Ohren,dachte Moritz. Meine Mutter, sagte der Esel,befindet sich auf dem Nachhauseweg. Willst dunicht zu ihr?, fragte Moritz. Sie ist noch weit weg,war die Antwort. Esel haben ein sehr gutes Gehör.Du darfst dich nicht wundern, wenn ich währenddes Gehens immer wieder stehenbleibe und dieOhren spitze. Ich merke eine Gefahr, ehe du siesiehst.Wo ist deine Mutter?, fragte Moritz. Im Wald, sagteder Esel. Die Bäurin sammelt Brennholz, meineMutter trägt es auf dem Rücken zum Bauernhof.Wenn sie hier ist, werde ich mich von ihrverabschieden. Moritz stellte sich vor, er müßtesich, wenn auch nur für einige Zeit, von seinerMutter verabschieden, und wurde traurig. Was wirdsie sagen?, fragte er. Sie wird froh sein, daß du michmitnimmst, antwortete der Esel. So hat sie eineSorge weniger.Du hast recht, sagte Moritz. Außerdem ist es keinAbschied für immer. Ich kehre nicht zurück,erwiderte der Esel. Moritz war überrascht undfragte: Das weißt du? Ja, das weiß ich, antwortete er.Ich bin, mußt du wissen, nie ganz getrennt vonmeiner Mutter. Wir sind über andere Tiere, vorallem die Krähen, stets in Verbindung. Du wirst siekennenlernen, ich werde ihnen von dir erzählen.Übrigens, wie heißt du?, fragte er. Moritz, war dieAntwort. Und du? Ich heiße Esel.Du solltest, fuhr er fort, zu deiner Großmuttergehen und ihr sagen, daß du mich mitnimmst. Sieist mit der Arbeit noch nicht fertig, sagte Moritz,legte sich neben den Esel ins Stroh und streicheltesein weißes Maul. Du bist ein schönes Tier, sagte er.Und du ein kräftiger Bub. Meine Großmutter, sagteMoritz, wird nichts dagegen haben. Sie wird,erwiderte der Esel, sicher nichts dagegen haben.Woher weißt du das?, fragte Moritz. Das sehe ich,antwortete der Esel. Ich sehe, wie sie arbeitet, wiesie die Mistgabel bewegt, wie sie den Mist mit derScheibtruhe wegkarrt, wie sie geht und wie sie sichniedersetzt, um zu rasten. Daran erkenne ich, wasfür ein Mensch sie ist.Wie ist das, fragte Moritz, wenn ich mit meinerGroßmutter zu dir komme? Wirst du mit ihr redenwie mit mir? Moritz, sagte der Esel, seit einerEwigkeit ist es so, daß ein kleiner Esel, der voneinem Kind aus seinem Elend erlöst wird, mitdiesem Kind sprechen kann. Aber nur mit diesemKind. Würde ich das Wort an deine Großmutterrichten, verlöre ich auf der Stelle die Fähigkeit zusprechen. Ich rede mit dir auch nur, wenn niemandin der Nähe ist, der sehen oder hören könnte, daßwir miteinander sprechen. Du kannst immer mit mirreden, und ich werde, wenn andere dabei sind, sotun, als würde ich dich nicht verstehen.